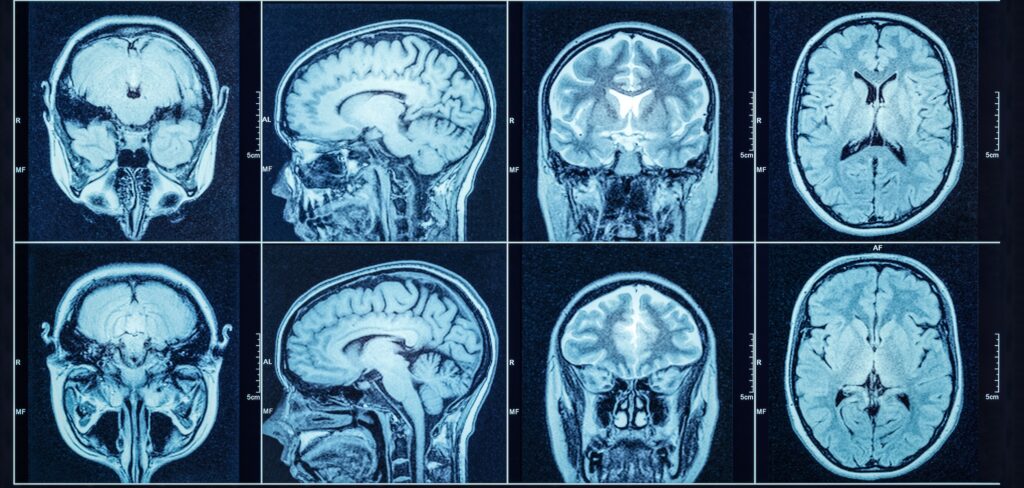Die UNO-City bleibt ein Sanierungsfall
Die Asbest-Sanierung ist längst abgeschlossen – doch viele Gefahren in den Gebäuden sind geblieben.

Das Vienna International Centre (VIC), besser bekannt als UNO-City, gilt als eines der markantesten Bauwerke der Bundeshauptstadt. 1979 an die Vereinten Nationen übergeben, beherbergt es heute Organisationen wie IAEO, UNOV, UNIDO und CTBTO. Doch das ikonische Areal in der Donaustadt ist in die Jahre gekommen. Der Investitionsrückstau ist beträchtlich – und die Kosten für die anstehende Gesamtsanierung sind explodiert. Aktuell wird von rund 330 Millionen Euro ausgegangen, ohne dass geklärt wäre, wer diese Summe trägt.
Asbest-Gefahr gebannt
Schon einmal stand der Gebäudekomplex im Zentrum eines Sanierungsstreits. Zwischen 2004 und 2013 wurde das VIC aufwendig asbestfrei gemacht. Damals mussten nach und nach alle Bauteile aus den 1970er Jahren von gesundheitsgefährdenden Materialien befreit werden. Die Republik übernahm den Großteil der Ausgaben – der genaue Kostenrahmen wurde nie vollständig öffentlich gemacht, soll aber bei über 300 Millionen Euro gelegen haben. Für die Sicherheit der Mitarbeitenden und Gäste war der Aufwand notwendig: In den alten Lüftungs- und Dämmstoffen hatte sich der gefährliche Baustoff großflächig befunden.
Warum Asbest ein Risiko bleibt
Asbest galt jahrzehntelang als Wunderbaustoff – hitzebeständig, isolierend, günstig. Doch die unsichtbaren Fasern haben fatale Folgen: Werden sie eingeatmet, können sie Jahrzehnte später schwere Krankheiten wie Lungenkrebs, Asbestose oder das besonders aggressive Mesotheliom auslösen. Das Risiko besteht vor allem bei Beschädigungen oder unsachgemäßer Entfernung. Deshalb war die kontrollierte Sanierung der UNO-City ein aufwendiger Kraftakt – mit Schleusen, Unterdrucksystemen und Spezialfiltern. Heute gilt der Gebäudekomplex als asbestfrei. Doch die Geschichte zeigt, wie lange Versäumnisse nachwirken können – finanziell und gesundheitlich.
Heute ist das Asbest längst verschwunden, doch die Finanzierungsdebatte hat sich verschoben – und sie beginnt erneut bei null.
Symbolmiete, reale Haftung
Eigentümerin der UNO-City ist nicht etwa die UNO selbst, sondern die Republik Österreich. Diese stellte das Gebäude einst zur Verfügung – als Gastgeber und Standortförderer. Die Organisationen zahlen seither eine symbolische Miete von 28 Cent jährlich. Im Gegenzug verpflichtet sich Österreich zu grundlegender Instandhaltung – mit gewissen Mitfinanzierungsregeln. Für kleinere Reparaturen gilt ein 50:50-Kostenschlüssel, gedeckelt mit sechs Millionen Euro jährlich. Doch bei einem Sanierungsbedarf von über 300 Millionen greifen diese Abmachungen nicht mehr.
Immerhin: Der Brandschutz wird bereits erneuert – auf Staatskosten. Die erste Bauphase in Höhe von 36 Millionen Euro wird derzeit vorbereitet. Die Feuerwehr kann derzeit nicht über die Steigleitungen bis in die oberen Stockwerke löschen. Haftungsfragen haben ein rasches Eingreifen erzwungen. Doch auch hier: Die UNO-Organisationen lehnten eine Kostenbeteiligung ab. Und selbst bei diesem vergleichsweise kleinen Betrag verhandelt Österreich nun mit der Stadt Wien um eine Refundierung von rund einem Drittel.
Viel brisanter aber ist die Frage, wie es weitergeht. Denn die wirklich teuren Maßnahmen – Austausch von Klima- und Heiztechnik, Modernisierung der Konferenzsäle, neue Dächer und Büroinfrastruktur – stehen noch bevor. Ob Wien, das Außenministerium oder die UNO-Zentrale in New York künftig zur Kassa gebeten werden können, ist unklar. Die Verhandlungen ziehen sich seit Jahren. Man hoffe auf das Prinzip „Steter Tropfen höhlt den Stein“, heißt es aus Diplomatenkreisen.
Die Asbestkrise mag Geschichte sein – aber das Sanierungsdilemma der UNO-City ist es nicht. Österreich sitzt auf hoher Symbolik. Und auf noch höheren Rechnungen.
(red)