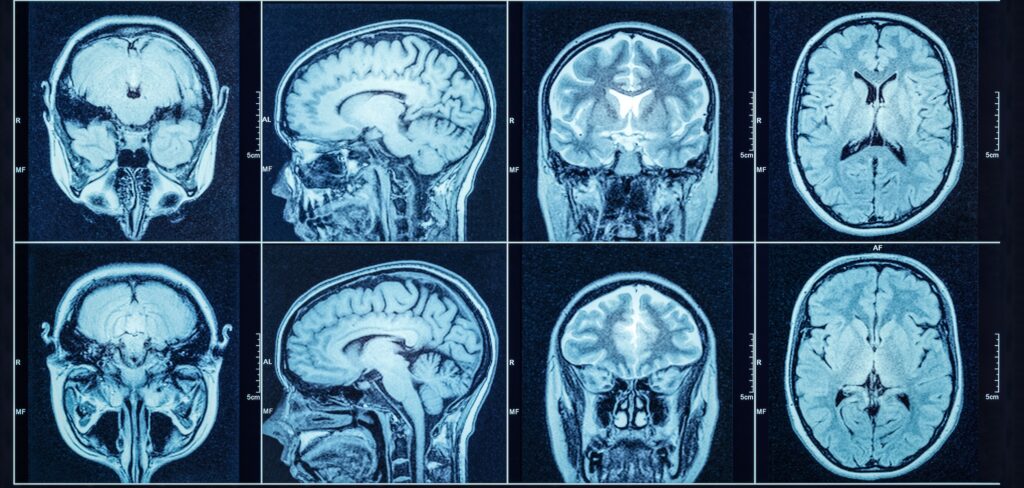Überlebenschance nach Herzinfarkt stark gestiegen
Noch in den 1970er Jahren galt der Herzinfarkt als medizinisches Todesurteil. Heute ist er oft beherrschbar.

Die drastische Senkung der Sterblichkeit bei Herzinfarkten – laut US-Daten um fast 90 Prozent seit 1970 – ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das deutlich bessere Erkennen von Symptomen. Während früher Schmerzen im Brustkorb oder Atemnot oft falsch gedeutet oder ignoriert wurden, wissen heute viele Menschen, dass es sich dabei um potenzielle Warnsignale handeln kann. Hinzu kommt: Der Weg ins Krankenhaus ist deutlich kürzer geworden – nicht geografisch, sondern strukturell. Die Einführung von Notrufsystemen mit standardisierter Erstversorgung, der Ausbau spezialisierter Notaufnahmen sowie der flächendeckende Aufbau sogenannter Chest-Pain-Units haben die Überlebenschancen maßgeblich verbessert.
Behandlungsmethoden im Wandel der Zeit
Ein Meilenstein in der Therapie war die Entwicklung der Thrombolyse, also der medikamentösen Auflösung von Blutgerinnseln, gefolgt von den heute gängigen interventionellen Verfahren: Mittels Katheter werden verschlossene Herzkranzgefäße wieder geöffnet, häufig durch das Einsetzen eines Stents. Diese minimalinvasiven Eingriffe haben die klassische Bypass-Operation in vielen Fällen ersetzt. Zudem hat die Versorgung unmittelbar nach dem Infarkt große Fortschritte gemacht – etwa durch bessere Überwachung auf Intensivstationen, individualisierte Medikamente zur Blutverdünnung und Cholesterinsenkung sowie eine engmaschige Nachbetreuung.
Heute zählt der Herzinfarkt nicht mehr automatisch zu den tödlichen Erkrankungen – wenn rasch gehandelt wird.
Risikofaktoren: Ernährung, Nikotin, Lebensstil
Trotz aller medizinischer Fortschritte bleibt der Lebensstil einer der größten Einflussfaktoren. In den 1960er- und 1970er-Jahren war der Zigarettenkonsum in der Bevölkerung hoch – auch unter jungen Erwachsenen. Gleichzeitig galten tierische Fette und Cholesterin noch lange nicht als gesundheitliches Risiko. Die Kombination aus Nikotin, ungesunder Ernährung, wenig Bewegung und unbehandeltem Bluthochdruck trug wesentlich zur damaligen Infarkt-Sterblichkeit bei.
Erst in den 1980er-Jahren setzte ein Umdenken ein – auch befeuert durch öffentliche Aufklärungskampagnen und erste strukturierte Vorsorgeprogramme. Heute sind Raucherquoten deutlich gesunken, und das Wissen über Risikofaktoren wie hohes LDL-Cholesterin oder familiäre Vorbelastung ist weiter verbreitet. Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes ermöglichen es zusätzlich, das Risiko für einen Herzinfarkt zu senken – oder einen zweiten zu verhindern.
Chronische Herausforderung
Während also die Zahl der tödlich verlaufenden Infarkte stark zurückgegangen ist, beobachten Kardiologinnen und Kardiologen seit einigen Jahren eine andere Entwicklung: Immer mehr Menschen überleben den ersten Herzinfarkt, leben danach aber mit einer chronischen Herzinsuffizienz oder anderen Folgeerkrankungen. Der medizinische Fortschritt rettet Leben – verlangt aber auch langfristige Betreuung und Prävention.
Für Patientinnen und Patienten bedeutet das: Ein überstandener Infarkt ist heute nicht mehr das Ende, aber auch nicht automatisch ein Neubeginn in alter Gesundheit. Entscheidend ist, wie konsequent Lebensstil und Behandlung angepasst werden – und wie gut die medizinische Versorgung aufgestellt ist.
(red)