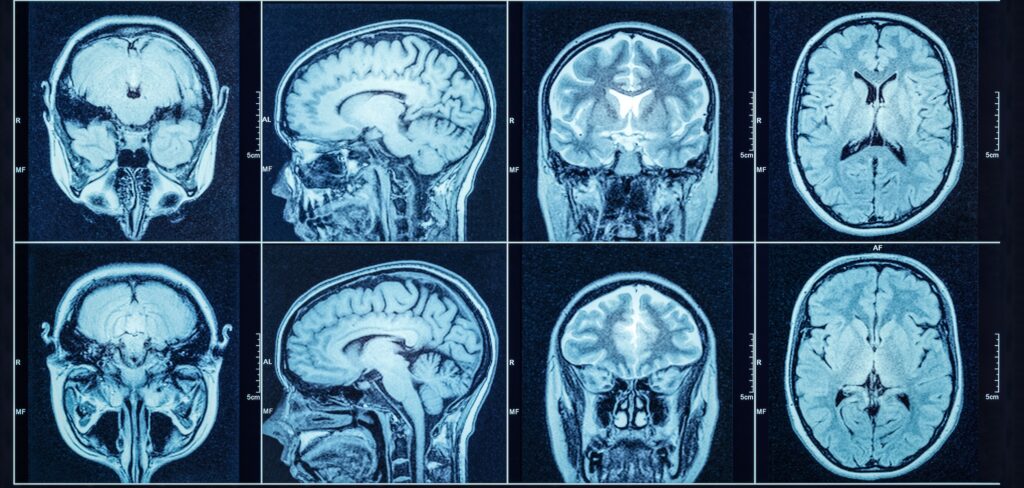Radioaktive Schwammerl: Was Tschernobyl hinterließ
Auch Jahrzehnte nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl ist in österreichischen Wildpilzen mitunter noch radioaktives Cäsium-137 nachweisbar.

Der Herbst ist die Zeit der Schwammerlsucher – ob Eierschwammerl, Steinpilz oder Maronenröhrling, das Sammeln in heimischen Wäldern gehört für viele Österreicher zum Jahreslauf. Doch seit dem Reaktorunglück in Tschernobyl 1986 begleitet ein Thema jede Pilzsaison: Radioaktive Belastung, vor allem durch das langlebige Isotop Cäsium‑137. Wie gefährlich ist der Verzehr heute wirklich? Und worauf sollte man als Sammler achten?
Lange Schatten über Europas Wälder
Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Die radioaktive Wolke zog über große Teile Europas – auch Österreich wurde stark getroffen. Besonders betroffen waren höher gelegene, bewaldete Regionen wie Kärnten, die Steiermark und Teile Salzburgs. Das Problem: Das langlebige Cäsium‑137 hat eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren. Auch knapp 40 Jahre später ist ein Teil davon noch immer in Waldböden aktiv – und damit auch in Wildpilzen und Wildtieren nachweisbar.
Cäsium in der Natur
Während landwirtschaftliche Böden durch Umgraben, Erosion und andere Prozesse das Cäsium nach und nach verloren haben, bleibt es in den humusreichen Waldböden oft länger aktiv. Pilze, die im Boden oder auf Totholz wachsen, nehmen das Isotop über ihr Myzel auf – und reichern es teilweise stark an. Einmal aufgenommen, wird das Cäsium beim Kochen nicht entfernt. Auch Trocknen oder Einfrieren hilft nicht – die Radioaktivität bleibt erhalten.
Heutige Belastung
In Österreich hat die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) in den letzten Jahren regelmäßig Pilze untersucht. Dabei zeigte sich ein differenziertes Bild: Eierschwammerl und Steinpilze sind meist unproblematisch. Sie liegen im Durchschnitt klar unter dem zulässigen Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm. Maronenröhrlinge hingegen fallen auf: Über die Hälfte der Proben überschreitet den Grenzwert. Sie gelten als besonders aufnahmefreudig für Cäsium. Andere Arten wie der Semmelstoppelpilz oder der Trompetenpfifferling können ebenfalls hohe Werte aufweisen – Daten dazu stammen v. a. aus Bayern und Süddeutschland, die auch Rückschlüsse auf Österreich zulassen.
Tatsächliche Gefahr
Ein gelegentliches Gericht mit belasteten Pilzen macht niemanden krank. Selbst wer einmal im Jahr eine Portion mit einem Wert von über 1.000 Bq/kg isst, nimmt dabei nur eine sehr geringe Strahlendosis auf – im Bereich von etwa 0,01 Millisievert. Zum Vergleich: Der jährliche Grenzwert für die zusätzliche Strahlenbelastung liegt bei 1 Millisievert. Laut Experten ist selbst ein regelmäßiger, moderater Verzehr von Wildpilzen nicht gesundheitsgefährdend, solange man es nicht übertreibt. Die Empfehlung lautet: Nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche – das reicht für eine gute Schwammerlpfanne, bleibt aber strahlenschutztechnisch unbedenklich.
Bedeutung für Schwammerlsucher
Für leidenschaftliche Schwammerlsucher in Österreich gilt: Wer regelmäßig in den heimischen Wäldern auf Pilzsuche geht, sollte einige einfache, aber wichtige Regeln beachten. Besonders wichtig ist es, auf die Herkunft der gesammelten Pilze zu achten. Denn Pilze aus höheren Lagen – etwa in Kärnten, der Steiermark oder Tirol – weisen tendenziell höhere Belastungen auf. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, greift zu Zuchtpilzen aus dem Supermarkt. Sorten wie Champignons, Shiitake oder Austernpilze sind garantiert frei von radioaktiver Belastung und eine gute Alternative – nicht nur in Zeiten erhöhter Vorsicht.
Auch Wildfleisch betroffen
Nicht nur Pilze, auch Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine können Cäsium über die Nahrung aufnehmen. In Österreich sind die Werte im Fleisch in der Regel niedrig, in Deutschland wurden aber vereinzelt noch höhere Belastungen gefunden – insbesondere bei Wildschweinen. Auch hier gilt: Ein gelegentlicher Braten ist kein Problem, regelmäßiger Verzehr sollte mit Bedacht erfolgen.
Vorsicht aber keine Panik
Die Strahlenbelastung durch Wildpilze in Österreich ist heute kein Grund zur Sorge – sofern man maßvoll genießt und auf die richtigen Sorten setzt. Wer sich beim Sammeln gut informiert und nicht täglich Pilze auf dem Teller hat, kann die Schwammerlsaison unbeschwert genießen. Ein bisschen Strahlung steckt zwar manchmal noch in der Pfanne – aber die echte Gefahr lauert wohl eher in falscher Bestimmung oder in verwechselbaren Giftpilzen als im Erbe von Tschernobyl.
(red)