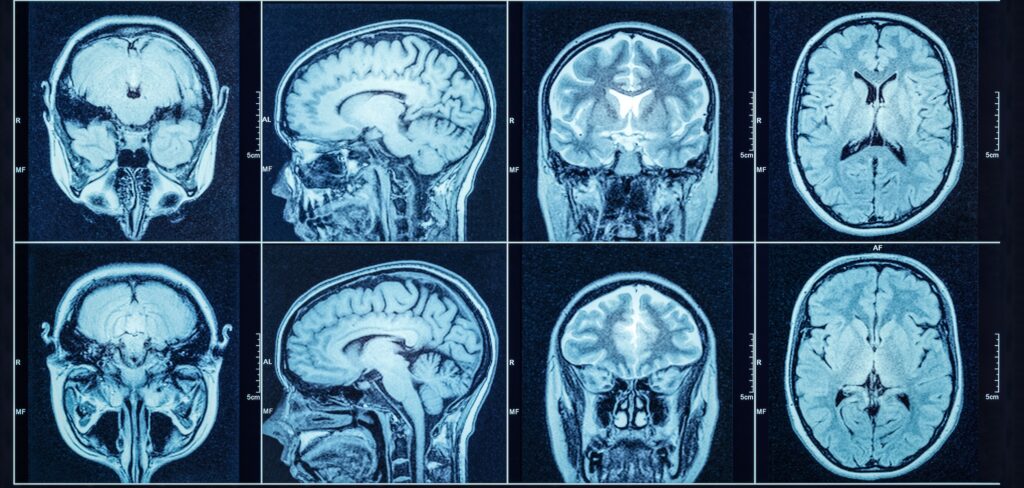Klimafolgenforschung in der Korrekturschleife
Eine der großen Klimastudien des vergangenen Jahres muss nachträglich korrigiert werden – weil Daten nicht stimmen.

Die Meldung klingt harmlos: Forschende des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) müssen ihre 2024 in Nature veröffentlichte Studie zu den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels überarbeiten. Ursache: fehlerhafte Wirtschaftsdaten aus Usbekistan aus den Jahren 1995 bis 1999. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein Randdetail – ist es aber nicht.
Denn diese Studie gehörte zu jenen viel zitierten Arbeiten, auf die sich Medien, NGOs und politische Entscheidungsträger stützen, wenn sie wirtschaftliche Schäden des Klimawandels beziffern. Prognosen über den Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung um 19 Prozent bis 2049 – selbst bei sofortiger Emissionsreduktion – sorgten für Schlagzeilen und stärkten jene, die mehr Klimaschutzmaßnahmen fordern. Nach der Korrektur sind es „nur“ noch 17 Prozent. Die Kernaussage bleibe gleich, betonen die Autorinnen und Autoren. Kritiker sehen das differenzierter.
Wissenschaft als politischer Multiplikator
In der Theorie soll Wissenschaft der Politik nüchtern Fakten liefern. In der Praxis geraten spektakuläre Studien schnell zu politischen Hebeln. Nicht, weil Forschende zwingend eine politische Agenda verfolgen – sondern weil ihre Zahlen sich hervorragend eignen, um politische Narrative zu stützen. Wer einen raschen Kurswechsel in der Klimapolitik fordert, hat mit dramatischen Prognosen das stärkste Argument.
Damit steigt aber auch der Druck, wissenschaftliche Ergebnisse medial wirksam zu inszenieren. Dass Fehler und methodische Schwächen dabei erst Monate später auffallen, ist kein Einzelfall. Der öffentliche Korrekturprozess, wie er nun bei dieser Studie stattfindet, ist zwar ein Zeichen funktionierender Wissenschaft – zeigt aber auch, wie leicht Forschungsergebnisse zu Verstärkern politischer Strategien werden.
Vom Expertentum zur Deutungshoheit
Klimaforschung ist komplex. Die zugrunde liegenden Modelle sind für Laien kaum nachvollziehbar, oft auch nicht für Politiker selbst. Das öffnet einer kleinen Expertengruppe die Tür zur Deutungshoheit: Sie liefern die Zahlen, die Medien übernehmen sie, die Politik formt daraus Handlungsdruck. Wer die Komplexität infrage stellt, riskiert schnell, als Wissenschaftsleugner abgestempelt zu werden.
Das Problem: Wenn Politik wissenschaftliche Prognosen vor allem als Steigbügel für bestehende Agenden nutzt – ob Klimaschutz, Machterhalt oder die Legitimation neuer Abgabenmodelle – verschwimmt die Grenze zwischen unabhängiger Forschung und politischem Werkzeug.
Vorläufiges Fazit
Die aktuelle Korrektur der Klimastudie zeigt: Wissenschaft kann sich selbst korrigieren – und muss es ab und zu auch medial inszenieren. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass Forschungsergebnisse nicht im luftleeren Raum wirken. Sobald sie die politische Bühne betreten, werden sie Teil eines Machtspiels. Wer sie dann hinterfragt, hinterfragt nicht nur Zahlen, sondern ein ganzes System, das auf Zahlen fußt.
ACHTUNG – SPERRFRIST
Dieser Artikel ging pünktlich am 6. August um 17:00 Uhr online. Top‑Secret‑Stuff, versteht sich. Schließlich konnte niemand verantworten, dass die Welt schon um 16:59 Uhr von einer korrigierten Klimastudie erfährt. Die Brisanz dieser Aussendung – fehlerhafte Usbekistan‑Daten aus den 90ern! – hat das natürlich enorm gesteigert. Dem wollten wir selbstverständlich Rechnung tragen.
(APA/red)