Maritime Hitzewelle im Mittelmeer und die Folgen
29 Grad im Mittelmeer – kein Badespaß, sondern ein ökologisches Warnsignal. Meeresbiologe Gerhard Herndl erklärt die Hintergründe.
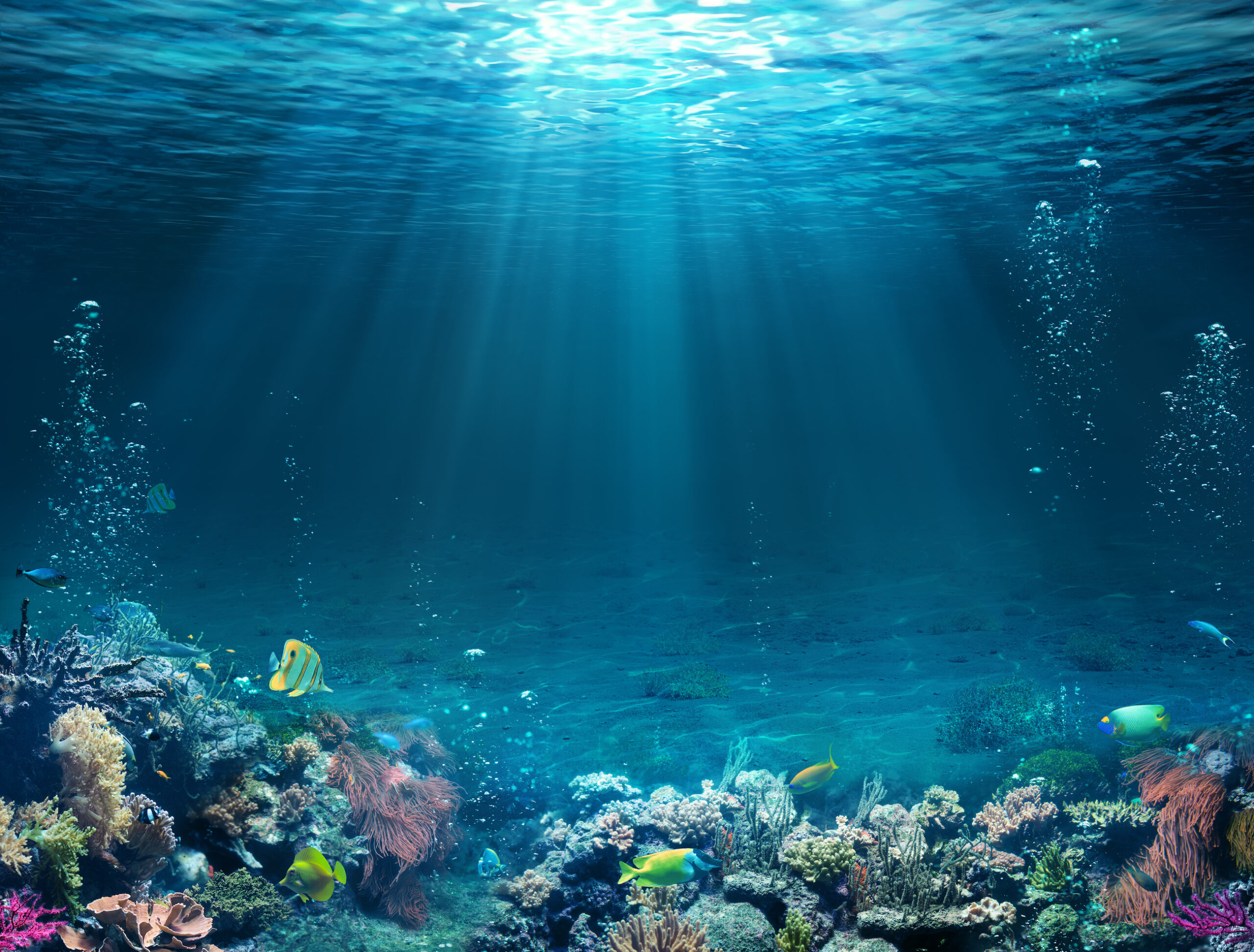
Zwischen Antibes und Villefranche-sur-Mer misst das Meer dieser Tage bis zu 29 Grad – nicht in geschützten Buchten, sondern im offenen Wasser. In der Region, die zu den wärmsten Abschnitten der französischen Mittelmeerküste zählt, wird das Baden im Hochsommer zur Herausforderung. Auch in anderen Teilen des Mittelmeerraums steigen die Temperaturen ungewöhnlich stark an: Entlang der kroatischen Adriaküste wurden im Juli vielerorts über 27 Grad gemessen, teils sogar mehr. Selbst in schattigen Küstenabschnitten oder zwischen Inselgruppen, wo sich das Wasser sonst langsamer erwärmt, fehlt mittlerweile jede Spur von Abkühlung.
Urlaub im Hitzebecken
Was früher selbst in Hitzesommern selten war, ist heuer Realität: kein kühlendes Eintauchen, sondern das Gefühl, in ein Thermalbecken zu steigen. Die Oberfläche des westlichen Mittelmeers ist so warm wie nie zuvor – und das hat Folgen. Was viele Urlauber überrascht, ist für die Klimaforschung ein klar benanntes Phänomen: eine maritime Hitzewelle, die sich nicht mehr als Einzelfall deuten lässt, sondern als Teil eines anhaltenden Musters.
Was das Mittelmeer zur Wärmeflasche macht
Um zu verstehen, was hinter dieser Erwärmung steckt, hat CheckList bei einem der führenden Ozeanologen Österreichs nachgefragt. Prof. Dr. Gerhard Herndl ist Professor für Meeresbiologie an der Universität Wien und leitet das Microbial Oceanography Lab. Seine Forschung reicht von der Tiefsee bis zur globalen Klimapolitik.
„Das ist keine Einzelerscheinung mehr“
Herndl bestätigt: „Das westliche Mittelmeer hat sich dieses Jahr deutlich stärker aufgeheizt als etwa die Adria.“ Dass Temperaturen um die 29 Grad erreicht werden, sei nicht mehr überraschend – sondern Teil eines größeren Trends. Satellitendaten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigen deutlich, wie sich Oberflächentemperaturen im Mittelmeerraum systematisch erhöhen. „Diese marinen Hitzewellen treten heute fast jährlich auf – früher lagen zehn Jahre dazwischen“, so Herndl.
Das Mittelmeer ist ein Sonderfall
Einen speziellen Effekt hat das Mittelmeer durch seine geografische Form. Da die Meerenge von Gibraltar nur rund 500 Meter tief ist, gelangt kaum kaltes Tiefenwasser aus dem Atlantik in den Binnenraum. „Das Mittelmeer ist wie ein Becken mit eigenem Kreislauf – in 2000 Meter Tiefe herrschen dort 13 Grad. Das ist extrem warm im Vergleich zum Atlantik.“ Durch die globale Erwärmung heizen sich nun auch die oberen Wasserschichten stärker auf.
Folgen für Artenvielfalt und Fischerei
Der Ozean reagiert auf diese Veränderungen mit biologischem Stress. Hitzeempfindliche Arten ziehen sich zurück, andere – wie fädige Algen – breiten sich aus. „Die Fische wandern in tiefere Wasserschichten, wo es kühler ist“, erklärt Herndl. Für die Küstenfischerei bedeutet das: Fangmengen sinken, die Artenzusammensetzung verändert sich. Besonders betroffen sind Seegraswiesen wie die Posidonia-Wiesen im Mittelmeer, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren.
Interview mit Prof. Gerhard Herndl
CheckList: Die Temperaturen im Mittelmeer liegen stellenweise bei 29 Grad. Ist das noch normal?
Herndl: Das ist mittlerweile gut dokumentiert. Copernicus – also das europäische Satellitenprogramm – hat das kürzlich mit einer Temperaturkarte belegt. Die Aufheizung ist besonders im westlichen Mittelmeerraum stark. Die Adria hat sich etwas weniger erwärmt, aber auch dort sind die Temperaturen hoch.
CheckList: Welche Ursachen stecken dahinter?
Herndl: Grundsätzlich ist das eine direkte Folge der globalen Erwärmung. Zusätzlich ist das Mittelmeer ein spezieller Fall. Es funktioniert wie ein abgeschlossenes Becken – durch die nur rund 500 Meter tiefe Schwelle bei Gibraltar kommt kaum kaltes Wasser aus dem Atlantik hinein. Dadurch ist das Tiefenwasser dort ungewöhnlich warm: In rund 2000 Metern Tiefe misst man 13 Grad. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass der Atlantik in solchen Tiefen nur 3 bis 4 Grad hat.
CheckList: Wir erleben also eine marine Hitzewelle?
Herndl: Ganz eindeutig. Diese Hitzewellen häufen sich in den letzten zehn Jahren deutlich. Früher gab es solche Phasen vielleicht einmal in einem Jahrzehnt – jetzt treten sie jährlich oder zumindest alle zwei Jahre auf. Und das hat Konsequenzen: Meeresorganismen geraten unter Stress, ganze Ökosysteme verschieben sich.
CheckList: Welche Arten sind besonders betroffen?
Herndl: Seegraswiesen zum Beispiel – etwa Posidonia oceanica, das sogenannte Neptungras. Diese Pflanzen vertragen die hohen Temperaturen schlecht. Stattdessen breiten sich fädige Algen aus, die damit besser klarkommen, aber weniger ökologischen Nutzen haben. Auch viele Fischarten ziehen sich in tiefere, kühlere Wasserschichten zurück. Das merken Fischer sehr schnell.
CheckList: Hat das auch Rückwirkungen auf das Klima in Europa?
Herndl: Das ist global zu betrachten. Solche Hitzewellen gibt es auch vor Florida oder am Great Barrier Reef. Aber natürlich wirkt sich das auch auf Wetterlagen und Strömungen aus. Warmes Oberflächenwasser verändert die Energieverteilung in der Atmosphäre – und das beeinflusst wiederum unser Wetter.
CheckList: Ihre Forschungsgruppe untersucht auch, wie der Ozean beim CO₂-Abbau helfen kann. Was ist der Ansatz?
Herndl: Der Ozean ist ein zentraler Teil des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Phytoplankton nimmt CO₂ auf, wandelt es in Biomasse um, und abgestorbene Partikel sinken in die Tiefsee – dort beginnt ein langsamer Speicherprozess. Wir beschäftigen uns in unserer Arbeitsgruppe auch mit der Frage, ob man diesen Prozess gezielt unterstützen kann.
CheckList: Also aktives CO₂-Senken durch den Ozean?
Herndl: Genau. Es gibt dazu ein UN-Programm, das „Ocean Negative Carbon Emissions“ heißt. Die Idee ist: Wenn wir es schon nicht schaffen, CO₂-Emissionen schnell genug zu reduzieren, müssen wir überlegen, wie wir CO₂ wieder aktiv aus der Atmosphäre holen. Der Ozean spielt da möglicherweise eine wichtige Rolle.
CheckList: Ist das auch praktisch umsetzbar?
Herndl: Es ist langfristig denkbar, aber keine einfache Lösung. Die CO₂-Konzentration lag über Jahrtausende zwischen 180 und 280 ppm – heute sind wir bei etwa 430. Wenn wir ein Plateau erreichen, bleibt der Wert auf diesem Niveau stehen. Von selbst geht er nicht zurück. Deshalb braucht es Konzepte, wie man CO₂ wieder aus der Atmosphäre entfernt – an Land oder im Meer. Ziel wäre es, langfristig wieder Richtung 300 ppm zu kommen. Aber das ist ein Prozess über Jahrzehnte.
Tiefsee, Kohlenstoff und CO₂
Herndls Forschung reicht weit über die Oberfläche des Mittelmeers hinaus. An der Universität Wien leitet er eine Arbeitsgruppe, die sich mit mikrobieller Ozeanografie beschäftigt – speziell mit dem Kohlenstoffkreislauf im Meer. Ein zentraler Fokus liegt auf der Tiefsee, jenem gigantischen Lebensraum unterhalb von 200 Metern, über den bisher vergleichsweise wenig bekannt ist. Dort wird abgestorbene Biomasse aus oberen Wasserschichten – etwa Planktonreste oder tierischer Kot – als „Partikelregen“ in die Tiefe transportiert ist die Basis des Nahrungsnetzes der Tiefsee. Mikroorganismen spielen eine bedeutende Rolle als Konsumenten von organischem Material in der Tiefsee, aufgrund ihrer hohen Stoffwechselraten. Dieser Prozess ist ein wesentlicher Bestandteil des globalen Kohlenstoffsystems und spielt eine entscheidende Rolle bei der langfristigen Bindung von CO₂ im Ozean.
Aktuell arbeitet Herndl auch an internationalen Forschungsprojekten, die das Potenzial des Meeres zur aktiven CO₂-Senkung untersuchen. Hintergrund ist die dramatische Entwicklung der atmosphärischen CO₂-Konzentration, die inzwischen bei etwa 430 ppm liegt – ein historischer Höchstwert. Anders als oft angenommen, sinkt dieser Wert nicht von selbst. Ziel solcher Forschungsinitiativen ist es daher, Wege zu finden, wie der Ozean dabei helfen könnte, CO₂ gezielt zu binden und langfristig zu speichern. Lösungen dafür zeichnen sich erst langsam ab – doch eines ist klar: Ohne den Ozean wird es keinen funktionierenden Klimaschutz geben.
Forschung, die in die Tiefe geht
Forschung wie jene von Prof. Herndl an der Universität Wien leistet einen entscheidenden Beitrag, um diese Entwicklungen zu verstehen und langfristig lenken zu können. Seine Arbeit reicht von den biogeochemischen Prozessen in der Tiefsee bis zur Rolle des Ozeans als Kohlenstoffspeicher. Dabei geht es um nichts Geringeres als die Fähigkeit der Meere, überschüssiges CO₂ nicht nur aufzunehmen, sondern es auch in Formen zu überführen, die für Jahrhunderte im System verbleiben – fernab jeder kurzfristigen Kompensation.
Die Tiefsee, so unsichtbar sie für die meisten bleibt, spielt dabei eine Schlüsselrolle: als globales Transportmedium für Kohlenstoff, als Regulationsraum für Temperaturdynamiken, als Rückgrat eines Systems, das ins Wanken gerät. Die Konsequenzen sind weitreichend: für die Stabilität mariner Nahrungsketten, für den atmosphärischen Kohlenstoffhaushalt – und letztlich auch für die Frage, ob das Meer ein Partner bleibt oder zum Verstärker der Klimakrise wird.
(key)




